Interne Reibereien bremsen dein Team aus? Entdecke, wie du die Gruppendynamik entschlüsselst, Herausforderungen mutig begegnest und eure Gemeinschaft stärkst
Im Laufe meines Lebens habe ich in vielen Teams gearbeitet. Beruflich und um die Welt zu verbessern. Manchmal beides. Ich war politisch aktiv, hatte ein Unternehmen, mit mehreren Partnern und engagiere mich heute im Aufsichtsrat unserer Wohnungsgenossenschaft: Ich kann auf über vier Jahrzehnte „Teamwork“ zurückschauen. Das meiste davon war harte Arbeit. Ilona würde wohl sagen, dass ich heute eher der Typ Einzelgänger bin. Und zum Teil stimmt das. Aber mir bringt es Spaß, gemeinsam mit anderen Menschen etwas zu bewirken.
Wie gesagt, im Team die Welt zu verändern ist echt nicht einfach. Oft hat es was von einem Marathon im Treibsand. Besonders dann, wenn man immer wieder Verhaltensmuster erlebt, die gute Ideen lähmen, manchmal ganz und gar unmöglich machen. Aber mein Erfahrung ist auch, dass es nur so geht. Wer wirklich was erreichen und die Welt verbessern will, schafft das nicht allein. Die Fragen sind immer: Ziehen alle an einem Strang oder wird es eher ein Tauziehen? Kann man die Probleme lösen, die sich aus der Gruppendynamik ergeben? Steht in der Gruppe Gemeinwohl vor Eigennutz?
Ein Boot fährt nicht vorwärts, wenn jeder auf seine Weise rudert.
(Afrikanisches Sprichwort)
Warum unser Engagement oft scheitert
Teams haben eine enorme Kraft, die Welt zu verändern – ich glaube fest daran. Es gibt so viele Beispiele. Doch immer wieder erleben gerade engagierte Gruppen herbe Enttäuschungen: Machtspiele, Frust und Blockaden verhindern den gemeinsamen Erfolg. Und das schmerzt besonders, weil man ja mit so viel Idealismus an die Sache gegangen ist.
Kennst du das Gefühl, wenn dein tiefer Wunsch nach Wandel in der Zerstrittenheit eines Teams zu versinken droht? Oder man einfach feststeckt. Man sich nicht auf das Wie einigen kann? Das Was? Oder Warum genau? Furchtbar. Es passiert nie gleich am Anfang, sondern schleicht sich ein, sobald aus einer gemeinsamen Idee erste Strukturen oder sogar Institutionen wachsen. Glücklich die, die das in ihrem Teams nie erlebt und Mittel dagegen haben. Mittel, die nicht darauf bauen, das jemand das Sagen hat und alle hinterher laufen. Das es keine Kämpfe um Dominanz und Richtungskämpfe gibt. Sondern alle sich einbringen können und gehört werden. Von ihnen können wir nur lernen.
Ganz oft habe ich es erlebt, dass einzelne Teammitglieder alles taten, um die Führung an sich zu reißen. Weil sie meinten, dass sie am besten wüssten, was zu tun wäre. Und das auch so energisch vertraten, dass andere ihnen einfach folgten, plötzlich unkritisch wurden und sogar alle die angingen, die vor unbedarften Schritten warnten.
Alphas, Betas, Gammas und Omegas
Die Psychoanalyse und Sozialpsychologie kennt diese typische Rollen, die ein Team prägen. Ich habe vor einigen Jahren davon gelesen. Und auch wenn ich weiß, dass alles natürlich viel komplizierter und komplexer ist, hat es mir enorm geholfen, ein paar Grundmechanismen der Gruppendynamik zu begreifen. Ich lernte die Alphas, Betas, Gammas und Omegas kennen. Rollen innerhalb einer Gruppe, die reale soziale Muster widerspiegeln, wie Raoul Schindler bereits Mitte des 20. Jahrhunderts zeigte [1].
Ein Alpha führt (oder will es zumindest), Betas unterstützen und vermitteln, Gammas folgen als Mehrheit, Omegas bringen Kritik und Außenperspektiven ein. Werden diese typischen Rollen starr oder unreflektiert, entfachen sie Konflikte, die den Rückhalt im Team brechen. Das soziale Gefüge wird zum Minenfeld. Erkennt man sie, ergibt sich die Möglichkeit die Dynamiken in der Gruppe zu reflektieren, daraus zu lernen und Potenziale zu entfalten. Und das braucht es, wenn man sich doch eigentlich für eine bessere Welt einsetzen will.
Diese Rollen sind fluide und entstehen erst durch die Anerkennung der Gruppe; sie sind keine festen Persönlichkeitsmerkmale, sondern dynamische Positionen in gruppendynamischen Prozessen, die zusammen das soziale Gefüge einer Gruppe prägen und sowohl Stabilität als auch notwendige Dynamik ermöglichen. Und gerade wenn es um viel geht, die Aktivitäten, Wünsche und Aktionen ethisch geprägt und emotional aufgeladen sind, kann es ziemlich dynamisch werden.
Rollen reflektieren und Phasen mutig durchlaufen
Als ich mir diese vier Gruppentypen mal näher ansah, stellte ich fest, wie wichtig jede der Rollen für die Team-Entwicklung ist. Wie sie sich gegenseitig stützen oder behindern können und welche Phase man in einer Gruppe bei der Findung der eigenen Rolle und Akzeptanz der anderen durchläuft.
Alpha: Visionär, voller Antrieb und Inspiration
Die Alpha-Person ist oft charismatisch (zumindest durchsetzungsstark) und übernimmt oft sichtbar die Führung. Im besten Fall hat sie das Mandat aller dazu. Sie steuert Visionen, gibt Impulse und motiviert das ganze Team. Doch feste Alpha-Herrschaft erzeugt das Risiko, andere Stimmen zu unterdrücken, allein zu entscheiden und sich mit Menschen zu umgeben, die einen permanent bestätigen. Und das steigert bei den anderen die Frustration und die Gefahr innerer Widerstände. Wenn Alpha-Rollen unreflektiert sind, werden sie zur Quelle von Machtmissbrauch und bremsen unser Engagement [1]. Reines Gift für eine bessere Welt, denn etabliert sich so eine Struktur, entstehen feste hierarchische Beziehungen, die verhärten und die Lust am Projekt nehmen.
Beta: Brücke und doppelte Batterie
Beta-Personen zeichnen sich durch ihre Fähigkeit aus, die Führung zu stützen und gleichzeitig als Diplomatinnen und Diplomaten zwischen den Alphas und dem Team zu vermitteln. Sie haben oft Organisationstalent und soziale Sensibilität, die sie zu wichtigen Stabilisatoren machen. Ohne Beta-Personen droht der Riss zwischen Führung und Basis. Aber es gibt auch Begehrlichkeiten, denn um diplomatisch zu sein, braucht es nicht nur Geschick, sondern genug Kraft auch Nein sagen zu können. Und wer dass zu häufig tut, wird bald als Omega-Störfaktor empfunden (siehe unten).
Gamma: Mehrheit und Fundament
Gamma-Personen bilden das Herz eines jeden Teams. Als die breite Masse sorgen sie für Beständigkeit, Akzeptanz und Umsetzung der Aufgaben. Ihre passive oder aktive Mitwirkung entscheidet, ob das Team handlungsfähig bleibt. Mangelnde Beteiligung von Gamma-Personen führt oft zu Gruppendenken oder Lethargie. Du kennst das vielleicht, wenn sich das Team in immer kleinere Grüppchen aufspaltet und das große Wir-Gefühl verloren geht. Und auch, wenn die Anerkennung ausbleibt, verlieren die Gammas schnell an Motivation, verlieren die Lust und die Gruppe bricht auseinander.
Omega: Rebellischer Spiegel und Innovation
Omega-Personen sind die kritischen Geister, die anders denken, Fragen stellen und bestehende Ordnungen (permanent) in Frage stellt. Ihnen haftet oft der Makel des Außenseiters und Störfaktors an. Gerade diese Rolle hat aber eine hohe Bedeutung, weil sie vor Gruppendenken schützt und Innovation initiiert. Werden Omegas ausgegrenzt, verliert das Team wichtige Impulse für eine bessere Zukunft und kann seine Potenziale nicht voll entfalten. [2] Ich persönlich rechne mich eher dieser Gruppe zu und weiß, dass man als Omega nicht gerade Sympathie-Punkte sammelt.
Rollen im Zusammenspiel und Konfliktdynamik
Die Spannung zwischen den Rollen ist fruchtbar, birgt aber hohes Konfliktpotenzial: Alpha- und Beta-Personen kämpfen um Einfluss, Gamma-Personen ringen um klare Orientierung, Omega-Personen drücken Kritik aus. Wird diese Dynamik starr, verstärkt sie Selbstblockaden und Spaltung. Unser Engagement leidet. Und hier wird es spannend …
Die sozialpsychologische Forschung (u.a. Lewin, 1948; Schindler, 1957) zeigt, dass die Kunst gerade darin liegt, Rollen bewusst zu reflektieren, flexibel zu halten und Macht gemeinsam zu verteilen. So entstehen kollektive Intelligenz und resiliente Teams, die den Herausforderungen des Engagements gewachsen sind und ihre Potenziale voll ausschöpfen können.
Teamphasen – Schauspiel in fünf Akten
Bruce Tuckman hat 1965 mit seinem Phasenmodell das Wesen von Teamprozessen eingefangen, 1977 ergänzt um Adjourning, die Abschlussphase [3][4].
Neben den Rollen ist das Team als Ganzes einem steten Entwicklungsprozess unterworfen. Das Phasenmodell beschreibt, wie Gruppen sich durch fünf Phasen bewegen. Dieses dynamische Verständnis ergänzt das Rollenmodell, denn es zeigt: Konflikte sind normal, ja notwendig, um weiterzukommen und unser Engagement zu stärken. Keine bessere Welt ohne Entwicklung. [3][5]
Unsere Tugenden und unsere Fehler sind untrennbar miteinander verbunden, wie Kraft und Materie. Wenn sie sich trennen, ist der Mensch nicht mehr da.
(Nikolai Tesla, aus ‚The Problem of Increasing Human Energy‘, Century Illustrated Magazine, Juni 1900“)
Dazu kommt: Je größer der Druck von außen, etwa von Politik oder gesellschaftlichen Gegnern, desto größer ist die Bedeutung von innerem Zusammenhalt; doch genau hier versagen Teams oft. Nur wer die innere Dynamik kennt und aktiv gestaltet, bleibt handlungsfähig und kann die Vision einer gerechteren, nachhaltigeren Welt vorantreiben. Wir müssen lernen, unsere Potenziale voll zu entfalten. Und das können wir, wenn wir die fünf Phasen anschauen.
- Forming (Orientierungsphase): Der Anfang. Das Team lernt sich kennen, Rollen sind unklar, die Dynamik vorsichtig. Alles ist getragen von einer gemeinsamen, oft nicht ausformulierten Idee.
- Storming (Konfliktphase): Machtkämpfe und Widerstände leben auf. Und hier prallen im Besonderen die Rollentypen aufeinander. Jetzt gilt es, sie zu erkennen und auftretende Konflikte zu meistern.
- Norming (Normierungsphase): Die Rollen und Normen werden ausgehandelt, das Team kann sich stabilisieren.
- Performing (Leistungsphase): Jetzt beginnt das effektive, kooperative Arbeiten mit flexiblen Rollen. Hier entfalten sich bestenfalls die Potenziale aller und der Gruppe als Ganzes.
- Adjourning (Auflösungsphase): Abschluss und Reflexion. Wird oft unterschätzt. Doch in dieser Phase legen wir die Weichen für unser zukünftiges Engagement und die Bildung eigener Initiativen und Gruppen aus.
Gerade die „Storming-Phase“ ist entscheidend: Konflikte zwischen Alpha-, Beta-, Gamma- und Omega-Menschen müssen hier erkannt und konstruktiv bearbeitet werden, um in die produktive Phase zu kommen. Forschungen bestätigen, dass diese bewusste Begleitung gruppendynamischer Prozesse essentiell für Erfolg ist und uns dabei hilft, unsere Ziele zu erreichen und unser Engagement zu bewahren [6][7].
Im „Storming“ zeigen sich besonders die Rollenkonflikte: Alpha versucht zu führen, Beta vermittelt, Gamma sucht Halt und Omega gibt kritische Impulse. Ein Team, das hier durch Reflexion und geteilte Verantwortung die starren Muster durchbricht, erreicht schneller stabile Zusammenarbeit (Norming) und kreative Leistung (Performing). Nur so können wir unsere Potenziale voll entfalten.
Tipps: So nutzt ihr Macht positiv und überwindet Widerstände
Der wichtigste Schritt ist die Reflexion der eigenen Rolle. Fragt euch ganz ehrlich: Welche Rolle nehmt ihr eigentlich in der Gruppe ein? Nur so könnt ihr eure Wirkung verändern und flexibel sein. Denkt daran: Jede und jeder von euch hat das Potenzial, aktiv zu gestalten und sich mit Engagement sinnvoll einzubringen [8].
Verteilt Verantwortung rotierend, um Machtansammlungen zu verhindern und neue Impulse zuzulassen. Transparente, offene Kommunikation und regelmäßige Feedback-Runden machen Macht sichtbar und verhindern dunkle Ecken. So meistert ihr Konflikte, bevor sie überhaupt eskalieren.
Umgang mit dominanter Dynamik: Wenn Einzelne zu viel Raum einnehmen
In jedem Team kann es Situationen geben, in denen besonders dominante Persönlichkeiten – oft unbewusst – den Raum für andere einnehmen, Diskussionen an sich reißen oder Entscheidungen vorwegnehmen. Dies kann das Engagement anderer Teammitglieder hemmen und die Entfaltung kollektiver Potenziale blockieren. Es ist mutig und notwendig, solche Dynamiken anzusprechen.
Konkret solltet ihr als Teammitglieder oder Führungspersonen aktiv intervenieren: Schafft bewusst Raum für ruhigere Stimmen, indem ihr gezielt nach deren Meinung fragt („Was denkst du dazu, [Name]?“). Etabliert klare Gesprächsregeln, die alle zu Wort kommen lassen und Redezeit begrenzen. Bei wiederholter Dominanz ist ein direktes, aber konstruktives Feedback im Vier-Augen-Gespräch unerlässlich: Beschreibt die beobachtete Wirkung auf das Team und schlagt konkrete Verhaltensänderungen vor. Externe Moderation kann hier ebenfalls wertvolle Unterstützung bieten, um festgefahrene Muster aufzubrechen und eine ausgewogenere Beteiligung zu fördern.
Übrigens: Burnout entsteht oft durch überlastete Alpha- oder Beta-Rollen. Fördert Selbstfürsorge, achtet Grenzen und sorgt für Pausen. Nur so bleibt ihr langfristig handlungsfähig und könnt euer Engagement aufrechterhalten.
Fridays for Future ist ein inspirierendes Beispiel dafür, wie rotierende Sprecherinnen und Sprecher und vielschichtige Arbeitsgruppen Macht teilen und Team-Dynamik lebendig halten, trotz externem Druck. Sie zeigen uns, wie wir Widerstand leisten und gleichzeitig solidarisch bleiben können, um gemeinsam die Welt zu verändern.
Wie Teams wirklich zusammenwachsen
Und wie sollte es aussehen? In einem idealen Team stimmt die Balance zwischen individuellen Stärken der Rollen und dem gemeinsamen Miteinander. Macht ist Verantwortung, verteilt und transparent. Konflikte sind Impulse, um zu wachsen, nicht Machtkämpfe. Teams sollten diese Ideale leben und ihr Engagement voll entfalten.
Jede Persönlichkeit bringt einzigartige Fähigkeiten ein – und alle werden wertgeschätzt. So entsteht eine kreative, resiliente und wirksame Gemeinschaft, die gesellschaftlichen Wandel vorlebt und unsere Utopien Wirklichkeit werden lässt. Man entfaltet die Potenziale, um gemeinsam die Welt zu verändern. Wissenschaftlich gesehen spiegelt das die perfekte Balance von Individualität und Gemeinschaft wider, Grundstein demokratischer und nachhaltiger Entwicklung.
Mit Bewusstsein, Offenheit und Engagement kannst du ein Team gestalten, das gemeinsam neue Wege geht und für eine bessere Welt kämpft.
Checkliste: Euer Team stark machen
- Reflektiert eure eigene Rolle und Wirkung im Team. Der erste Schritt zur Veränderung.
- Fordert offene und transparente Kommunikation ein.
- Verteilt Führungs- und Verantwortungsrollen regelmäßig rotierend.
- Setzt klare Gesprächsregeln und Konfliktmediation ein, um Konflikte zu meistern.
- Fördert Beteiligung aller und wertschätzt unterschiedliche Perspektiven.
- Erkennt den Wert kritischer Stimmen (Omega-Rollen) für das Team – sie sind euer Schutz vor Gruppendenken und helfen, Potenziale zu entfalten.
- Achtet und fördert Selbstfürsorge, damit euer Engagement nachhaltig bleibt.
- Entwickelt gemeinsam klare, geteilte Werte als Leitplanken des Handelns.
- Nutzt die Erkenntnis vom Phasenmodell, um Konflikte als Entwicklungsprozess zu verstehen und mutig anzugehen.
- Vergesst nicht, einzelne Meilensteine und das Ende des Projektes zu feiern und euch Mut für kommendes Engagement zu machen.
Optional: Kleiner Selbsttest zur Selbstreflexion und Teamdynamik
Diese Fragen helfen euch, Muster zu erkennen und Bewusstsein für Team- und Machtprozesse zu schaffen. Am meisten bringt es, wenn ihr euch über die Ergebnisse austauscht und gleich überlegt, was ihr ändern wollt – und auch, wo es vielleicht schon richtig gut läuft.
- Welche Rolle nimmst du im Team am häufigsten ein?
- Alpha: Ich übernehme gerne Führung und Entscheidungen.
- Beta: Ich unterstütze und vermittle zwischen anderen.
- Gamma: Ich folge und bringe Stabilität.
- Omega: Ich hinterfrage und bringe neue Perspektiven ein.
- Wie geht euer Team mit Konflikten in der Storming-Phase um?
- Wir ignorieren und vermeiden sie.
- Wir sprechen sie offen an und suchen Lösungen.
- Konflikte führen oft zu Spaltungen.
- Wir brauchen oft externe Moderation.
- Verändert sich eure Rollenverteilung mit der Zeit?
- Ja, wir wechseln Aufgaben regelmäßig.
- Nein, die Rollen sind starr zugeteilt.
- Wie wichtig sind Selbstfürsorge und Pausen im Team?
- Sehr wichtig und regelmäßig umgesetzt.
- Wir haben wenig Zeit dafür.
Ich bin gespannt, welche Erkenntnisse du daraus ziehst und wie ihr als Team euer Engagement für eine bessere Welt noch effektiver gestalten könnt! Du hast noch Ideen und Anregungen für andere, dann hinterlasse ein Kommentar.
Viel Erfolg für Dein Engagement!
Quellen
- [1] BGM Podcast – Teamdynamik verstehen: Die Rollen von Alpha, Beta, Gamma und Omega (o.D.): https://www.bgmpodcast.de/teamdynamik-verstehen-die-rollen-von-alpha-beta-gamma-und-omega
- [2] Alexander Woerlsinger – Rollen in Gruppen: Das rangdynamische Positionsmodell nach Raoul Schindler (o.D.): https://www.alexander-woerlsinger.de/rollen-in-gruppen-das-rangdynamische-positionsmodell-nach-raoul-schindler/
- [3] Upgreat – Phasenmodell der Teamentwicklung nach Tuckman (o.D.): https://www.upgreat.de/phasenmodell-der-teamentwicklung-nach-tuckman-5573
- [4] IO Business – Checkliste Teamentwicklung (2010): https://io-business.de/wp-content/uploads/2010/06/06_11_05_Checkliste_Teamentwicklung.pdf
- [5] Job-Union – Rollen im Team: Das perfekte Team zusammenstellen (o.D.): https://job-union.de/rollen-im-team-das-perfekte-team-zusammenstellen/
- [6] Karrierebibel – Belbin Teamrollen (o.D.): https://karrierebibel.de/belbin-teamrollen
- [7] wb-web – Rollen bei der Gruppenarbeit (o.D.): https://wb-web.de/material/lehren-lernen/rollen-bei-der-gruppenarbeit.html
- [8] Hej Agile – Rollen-Checkliste (o.D.): https://www.hejagile.de/s/Rollen-Checkliste.pdf



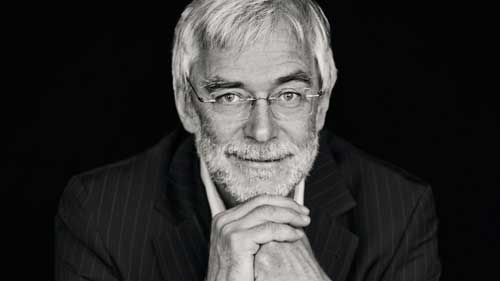

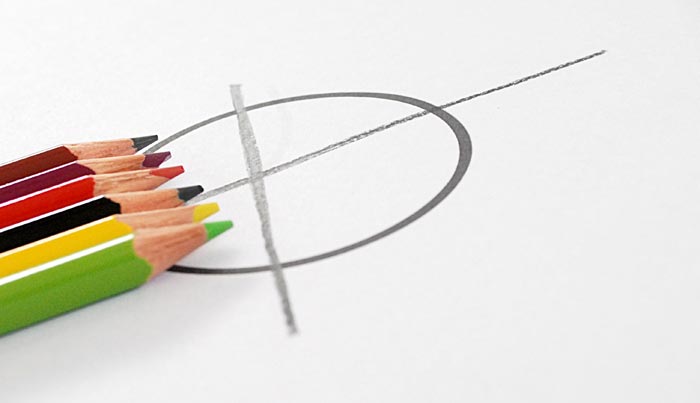
Hinterlasse einen Kommentar