Immer mehr Macht in immer weniger Händen. Erobern, ausbeuten, beherrschen, die Grundfesten einer Philosophie, die uns weismachen will, dass die Welt nur von den Stärksten gerettet werden kann. Das Gegenteil ist der Fall.
Der Geist der Zeit
Manchmal sitze ich da und reibe mir die Augen, bis es schmerzt. Wie kann es bitte sein, dass Menschen über uns Macht erlangen die dazu komplett ungeeignet sind? Die ihre persönlichen Interessen über das Gemeinwohl stellen? Über unser aller Wohl? Ein amerikanischer Pleitegeier aus der Welt der Luxus-Wolkenkratzer. Ein russischer KGB-Kraftprotz mit aufgeblasenem Ich. Der Manager einer globalen Geldscheffelmaschine, datengierige Tech-Nerd-Milliardäre, autoritäre chinesische Parteisoldaten, brutale Gotteskrieger, Ideologen, Menschenhasser, Egomanen? Das kann doch nicht wahr sein. Träume ich? Was für ein Club …
Und dann, wenn sich mein Würgereflex gelegt hat, reibe ich mir gleich noch mal die Augen. Denn ich erinnere mich voller Schrecken: Diese Menschen, die Machthaberinnen und Machthaber, stehen exemplarisch für uns und unsere Gesellschaft. Sie sind nicht die einzigen Fiesen da oben und wir die Netten hier unten. Sie spiegeln uns wieder. Aber was treibt uns an? Hierfür gibt es nur eine nachvollziehbare Antwort. Es geht um Macht. Die Macht des Stärkeren. Die Macht über andere. Die Macht, die Welt nach unseren eigenen Vorstellungen zu verändern. Und mehr noch, der damit verbundene Autoritätswahn durchzieht die Gesellschaften weltweit. Als wollten wir alle nichts anderes im Leben als erobern, ausbeuten und beherrschen. Der Ungeist geht um. Und wir lassen ihn gewähren.
Wir müssen uns diesem Missbrauch an Macht entgegenstellen. Aber wie?
Warum wachsen autoritäre Machtstrukturen in der Mitte der Gesellschaft?
Kommen wirklich immer die „Führungspersönlichkeiten“ an die Macht, die wir verdienen? Wie dumm können wir sein? Haben wir gar nichts aus der Geschichte gelernt? Ist das so eine periodische Sache, bei der sich alles wiederholt – auch das Schlimmste? Oder neigen wir einfach nur dazu, uns der autoritären Idee unterzuordnen, wenn wir glauben es ginge nicht anders? Und mit unterordnen meine ich nicht eine kleine Gruppe Durchgeknallter, sondern weite Teile der Gesellschaft, eine immer größer werdende Anzahl an Ländern auf diesem Erdball.
Die sich denkt: Ach, das wäre jetzt mal eine gute Idee, wenn ich richtig viel Macht hätte und manche von uns so viel davon, dass sie sich alles erlauben können. Vom Reiben tun mir die Augen weh. Aber ich möchte endlich wissen, warum so eine tragische Idee, wie die der Macht über andere wie ein Virus alle erfassen und so viel Unheil anrichten kann.
Die Konzentration von Macht ist eine gesamtgesellschaftliche Dynamik, die sich durch psychologische, soziale und ökonomische Mechanismen permanent verstärkt. Immer mehr. Die Leipziger Autoritarismus-Studie 2024 zeigt, wie autoritäre Einstellungen – also die Akzeptanz starker Führungsfiguren – in der Mitte der Gesellschaft expandieren. Unsicherheit, Kontrollverlust und der Wunsch nach einfachen Lösungen lassen den Ruf nach autoritärer Führung quer durch die politischen Lager wachsen [1]. Das fördert nicht nur Machtballung, sondern befeuert Polarisierung und latente Konfliktbereitschaft – bis hin zu Kriegen oder Scheitern dringend benötigter, kollektiver Lösungsansätze.
Und die Geschichte zeigt uns doch, dass das nicht gerade die beste aller Ideen ist. Und trotzdem glauben wir, dass es dieses Mal zu etwas Guten führen könnte … und lassen es geschehen oder machen sogar mit?
Erobern, ausbeuten, beherrschen?
Eine Philosophie, die die Macht über andere als legitimen Ausdruck des Stärkeren sieht suggeriert, dass nur durch Dominanz und Kontrolle wirklicher Fortschritt möglich sei. Diese Denkweise hat historisch Gesellschaften und politische Systeme geprägt, in denen Konkurrenz und Hierarchien als natürliche Ordnungen galten. Keine guten Zeiten für alle, die die Härte und Grausamkeit der Macht zu spüren bekamen. Und noch immer bekommen. Denn solche Vorstellungen führen zwangsläufig zu Unterdrückung, Ausbeutung und Spaltung der Gesellschaft. Moderne kritische Perspektiven rücken deshalb zunehmend Kooperation, Empathie und gemeinschaftliches Handeln in den Fokus, um nachhaltige Lösungen für die Herausforderungen unserer Zeit zu ermöglichen.
Neben der kritischen Abgrenzung von Machtsystemen weisen zahlreiche wissenschaftliche Studien mittlerweile darauf hin, dass Kooperation und Empathie entscheidend für das Überleben und Gedeihen von Gesellschaften sind. Empathie, also die Fähigkeit, sich in die Gefühle und Perspektiven anderer hineinzuversetzen, fördert nicht nur prosoziales Verhalten und soziale Bindung, sondern wirkt auch stressmindernd und unterstützt die Konfliktlösung. Studien zeigen, dass empathische Kommunikation sogar gesundheitliche Vorteile hat, indem sie Vertrauen fördert und die Resistenz gegenüber Belastungen stärkt [2].
Kooperation erhöht die Effizienz von Gruppen und hilft, komplexe Herausforderungen gemeinsam zu bewältigen, was insbesondere angesichts globaler Krisen lebenswichtig ist [3] [4] Dieses moderne Wissen verdeutlicht: Die Zukunft liegt in empathischen Netzwerken, das auf gegenseitigem Verständnis und gemeinschaftlichem Handeln basiert.
Und genau das ist es, was ich in meinem bisherigen Leben beobachtet habe. Überall wo jemand allein oder in einer kleinen Gruppe Macht über andere ausgeübt hat, ging es irgendwann fürchterlich nach hinten los. Natürlich gibt es auch jede Menge Beispiele für die weise, empathische und gütige Anwendung von Macht. Aber wie schnell kann daraus, wenn die Strukturen es erfordern, überhebliche Arroganz und dogmatische Selbstüberhebung, manipulative Emotionalität oder Passivität und ungesunde Duldsamkeit werden.
Hannah Arendt: Kritische Urteilskraft statt banale Anpassung
Viele erinnern sich bei der politischen Philosophin und Theoretikerin der Macht, Hannah Arendt, an ihre Beschreibung der „Banalität des Bösen“. Doch sie zeigt in „Eichmann in Jerusalem“ auch, dass das Böse vor allem dort entsteht, wo Menschen ihre Urteilskraft verlieren – wo blinde Routine, Anonymität und das Fehlen von empathischer Selbstprüfung herrschen [5]. Sie ruft dazu auf, sich eben nicht mit dem Status Quo abzufinden, sondern zivilen Ungehorsam und individuelle Verantwortung zu leben [6] Die Kernbotschaft: Nur durch aktives Urteil, Empathie, Mitdenken und Handeln können destruktive Machtmechanismen gebrochen werden.
Wir werden uns genau mit dieser Frage in der kommenden Zeit auseinandersetzen: Wie können wir durch aktives Urteil, Empathie, Mitdenken und Handeln destruktive Machtmechanismen brechen? Denn mehr und mehr stellt sich heraus, das der Missbrauch von Macht ein zentrales, wenn nicht sogar das zentralste Problem unserer Zeit ist.
Frames: Warum unser Denken geprägt wird
Der US-Kognitionsforscher George Lakoff beschreibt mit der Sprachwissenschaftlerin Elisabeth Wehling in dem Buch „Auf leisen Sohlen ins Gehirn“, dass gesellschaftliche Macht und Politik durch Bilder und Sprachmuster („Frames“) strukturiert werden, die unbewusst unser Denken lenken. Besonders fatal ist das „Strenger-Vater-Modell“: Führung und Gesellschaft werden laut Lakoff als autoritär, kontrollierend und hierarchisch gedacht, oft als natürliche Ordnung verkauft – wie die eines Vaters – und genau dadurch für autoritäre Politik und Machtmissbrauch geöffnet [7]. Lakoff stellt dem das Modell der Fürsorglichen Familie entgegen, in der Mitgefühl, Kooperation und eigene Verantwortung im Fokus stehen. Die Wahl, welches Prinzip dominiert, ist nicht trivial: Sie entscheidet über das gesellschaftliche Klima und die Reaktionsweisen in Krisen.
Lakoff erklärt, dass sich das Frame des strengen Vaters im Gehirn durch die wiederholte Verknüpfung von Autorität mit Kontrolle, Bestrafung und Gehorsam festsetzt. Es prägt neurologisch, wie Menschen Hierarchien und Moral verinnerlichen: Disziplin und Strafe werden als notwendige Mittel gesehen, um Sicherheit und Ordnung zu gewährleisten. Dieses neuronale Muster fördert rigides Denken, Angst vor Abweichung und ein starkes Bedürfnis nach Kontrolle – was autoritäre Politik und Machtmissbrauch begünstigt. Gleichzeitig minimiert es Offenheit für Dialog und Kooperation, da es vor allem auf Gehorsam statt auf gemeinschaftliche Verhandlung setzt.
Die dunkle Seite der Macht: Star Wars als Spiegel der menschlichen Schwächen
Es gibt wunderbare Romane, Theaterstücke und Filme zum Thema Macht. So wird das Motiv der Machtgier, des Kontrollverlusts und der inneren Zerstörung auch in popkulturellen Metaphern wie Star Wars bearbeitet. Wer sich der dunklen Seite der Macht hingibt, verliert Menschlichkeit und wird selbst zum Werkzeug der Zerstörung. Yoda bringt es auf den Punkt:
Der Weg zur dunklen Seite ist Wut, Angst und Aggression. Die dunkle Seite ist leichter, schneller und verführerischer – doch sie verbraucht dich.
(Yoda in Star Star Wars: Episode III – Die Rache der Sith [8]).
Star Wars lehrt, dass der innere Widerstand gegen die dunkle Seite genauso elementar ist wie der kollektive politische Widerstand. Ich habe mir zum Beispiel eine Weile lang immer wieder dieses Symbol der „Rebel Alliance“ besorgt [9]. Der kleinen Gruppe, die sich wacker gegen das Imperium stemmt. Es klebt auf meinem Fahrradhelm, meinem Rechner und an manch anderem Ort. Eingeweihte, wissen worum es geht. Aber eigentlich geht es um so viel mehr. Das Böse zu bekämpfen und Macht darüber zu erlangen, reden sich im Zweifel beide Seiten ein. Ist es nicht viel wichtiger, Macht mit anderen, statt über andere zu haben?
Die positive Seite der Macht
Einen anderen Blick auf die Macht gibt Eva Stützel in ihrem Buch „Macht voll verändern“. Darin zeigt sie, dass Macht nicht nur negativ verstanden werden sollte, sondern auch zahlreiche positive Seiten hat: Gestaltungsfreiheit, Selbstwirksamkeit und die Möglichkeit, gemeinsam mit anderen Projekte, Gemeinschaften oder Veränderungsprozesse anzustoßen. Gerade in Gruppen, die auf Augenhöhe und Gleichwürdigkeit setzen, kann ein bewusster, transparenter Umgang mit Macht Konflikte entschärfen und die Kooperation stärken.
Wenn Macht als Ressource und Gestaltungskraft genutzt wird, bringt sie Teams und Gemeinschaften nach vorne. Wer tiefer einsteigen möchte, findet HIER von Ilona eine ausführliche, praxisnahe Zusammenfassung und zahlreiche Inspirationen für einen neuen, konstruktiven Umgang mit Macht.
Wie kann ich gegen autoritäre Verführungen aktiv werden?
So bedrohlich die Entwicklungen erscheinen, die Gegenmacht beginnt immer bei der oder dem Einzelnen. Zivilcourage ist keine heroische Ausnahme, sondern eine tägliche Haltung. Es bedeutet, sich zu informieren, zu hinterfragen und nicht dem Strom zu folgen – Bildung und Information ist das Rückgrat. Im Alltag wachsen die Chancen, den autoritären Strukturen entgegenzutreten, wo Menschen Haltung zeigen: Im Gespräch, im Streit um Fakten, im Eintreten für Toleranz. Wer sich engagieren will, kann sich lokalen Initiativen, NGOs, Menschenrechtsorganisationen oder demokratischen Kampagnen anschließen.
Und genau das wollen wir mit unserem Projekt Für eine bessere Welt unterstützen: Aufklärung, Kompetenz und Gemeinschaft.
Die Fähigkeit, empathisch, aber zugleich renitent zu sein – also ein „Good Rebel“ – ist zentral: Aufstehen, wenn andere schweigen, und dabei nicht zynisch, sondern solidarisch handeln. Es sind viele kleine Handlungen, die den Unterschied machen und neue Räume für Demokratie und Mitmenschlichkeit schaffen. Lasst uns gemeinsam daran wirken, die Welt zu verbessern, bevor andere sie noch schlechter machen.
Mein erstes Fazit
Als Good Rebels bleiben wir der Menschlichkeit treu und widersetzen uns zugleich destruktivem Machtmissbrauch – mit Mut, Haltung, Empathie und Zuversicht. Die Geschichte zeigt: Nur da, wo viele aufstehen und sich bündeln, verliert die dunkle Seite ihre Macht. Wir müssen uns gegenseitig ermächtigen, anstatt Macht über andere haben zu wollen. So stark auch der Druck erscheint, um jeden Preis mächtig sein zu müssen.
Wenn wir die Mechanismen der Macht kennen und positiv nutzen, liegt darin echte Hoffnung auf eine Zukunft, in der Macht nicht zerstört, sondern verbindet. Die Hoffnung auf eine Zukunft für uns alle.
Ich glaube, dass die Liebe der eigentliche Sinn des Lebens ist. Wo es Liebe gibt ist kein Platz für Gewalt und Machtmissbrauch und Unterdrückung.“
(Astrid Lindgren, schwedische Kinderbuchautorin, Pippi Langstrumpf [10])
Quellen
- [1] „Leipziger Autoritarismus-Studie – Die Demokratie verliert Anhänger“ Deutschlandfunk: https://www.deutschlandfunk.de/autoritarismus-studie-2024-100.html
- [2] „Zusammenhänge zwischen Empathie, therapeutischer Haltung und Wirkeffizienz“ National Library of Medicine: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8062112
- [3] „Empathie als Fundament pädagogischer Professionalität: Analysen zu einer vergessenen Schlüsselvariable der Pädagogik. Dissertation“ LMU München: Fakultät für Psychologie und Pädagogik: https://edoc.ub.uni-muenchen.de/2514/
- [4] „Psychologische Grundlagen zwischenmenschlicher Kooperation“ Academia: https://www.academia.edu/52688791/Psychologische_Grundlagen_zwischenmenschlicher_Kooperation
- [5] „Hannah Arendt und der Eichmann-Prozess“ zeitgeschichte|online: https://zeitgeschichte-online.de/kommentar/hannah-arendt-und-der-eichmann-prozess
- [6] „Hannah Arendt – Politikwissenschaftlerin, Publizistin, Philosophin“ Landeszentrale für politische Bildung Baden-Würtemberg: https://www.lpb-bw.de/hannah-arendt-frau-im-fokus
- [7] Buch „Auf leisen Sohlen ins Gehirn“ Carl-Auer-Verlag: https://www.carl-auer.de/auf-leisen-sohlen-ins-gehirn
- [8] Yoda in Star Star Wars: Episode III – Die Rache der Sith: https://starwars.fandom.com/de/wiki/Yoda
- [9] Rebel Alliance, siehe Alliance to Restore the Republic: https://starwars.fandom.com/wiki/Alliance_to_Restore_the_Republic
- [10] Astrid Lindgren https://www.astridlindgren.com/de/zitate



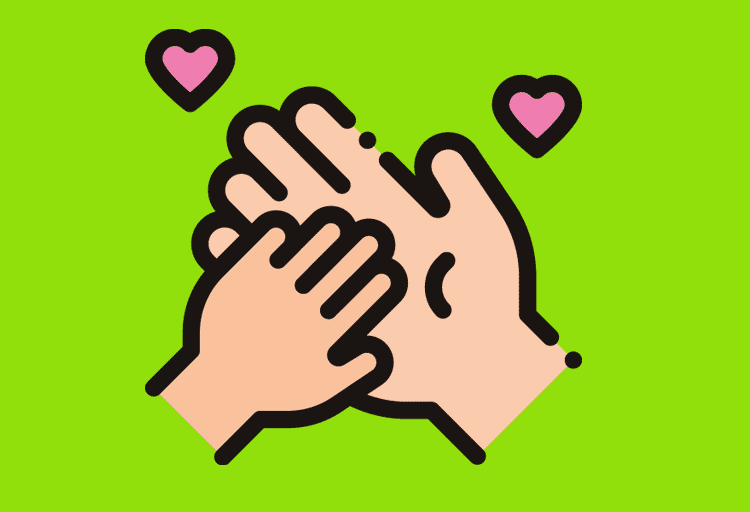

Hinterlasse einen Kommentar