Tobi Rosswog sieht Arbeit ziemlich kritisch. Für ihn ist sie die Ursache fast allen Übels in unserer Welt. Wieso? Das haben wir ihn gefragt. Ein Interview …
Warum ist Arbeit ein Problem?
Tobi Rosswog: Arbeit ist fast immer sinnlos, entfremdet, ausbeuterisch, krankmachend, zerstörerisch und hierarchisch. Denn: Ihr zugrunde liegt die Tauschlogik. Wir verkaufen unsere Lebenszeit an die Arbeitgeberin und machen im Gehorsam beinahe alles, was von uns verlangt wird. Das Prinzip von Leistung und Gegenleistung wird damit verfestigt und das führt zu Leistungszwang, Selbstverwertung und Optimierungswahn.
Wir arbeiten nicht aus intrinsischer, also innerlicher, sondern aus extrinsischer Motivation: für das Geld, mit dem wir unsere Grundbedürfnisse nach einem Dach über dem Kopf, einen gefüllten Bauch, Anerkennung und einigem mehr erfüllen. Das Konstrukt Arbeit hält ein System der Konkurrenz, des Gehorsams und vielem mehr aufrecht. Denn, wenn wir in der Reise nach Jerusalem um die letzten Arbeitsplätze noch einen Platz bekommen, bedeutet das notwendigerweise, dass eine andere Person ihn nicht bekommen hat. Sobald ich gesellschaftlich erfolgreich bin und aufsteige, bedeutet das logischerweise das eine andere Person herunter fahren muss. Anders geht es nicht. Im Buch zitiere ich Brecht, der es in einem wunderbaren Vierzeiler auf den Punkt bringt:
Reicher Mann und armer Mann
Standen da und sah’n sich an.
Und der Arme sagte bleich:
Wär ich nicht arm, wärst du nicht reich.
Und, wenn wir uns nochmal die ökologische Perspektive kurzerhand anschauen, stellen wir fest, dass seit 1972 und damit dem Bericht des Club of Rome mittlerweile allen bewusst ist, dass es auf einem begrenzten Planeten kein unendliches Wachstum geben kann. Die Wachstumslogik wird dank der Postwachstumsbewegung immer mehr hinterfragt. Das ist gut und wichtig. Allerdings fehlt dabei etwas entscheidendes: Wir stellen die Arbeitslogik kaum in Frage. Sie ist aber mit ihrem Produktivitäts- und Beschäftigungsfetisch dafür verantwortlich, dass destruktive Arbeit weiterhin legitimiert und praktiziert wird.
Das Arbeitsplatz-Argument a la »Hauptsache es gibt Arbeitsplätze« blendet alle. Egal, ob du mit deiner Arbeit im Kohlekraftwerk dem Klimawandel ordentlich einheizt oder in Großunternehmen andere Menschen global ausbeutest – es spielt keine Rolle. Die ökosoziale Perspektive wird im Namen der angeblich doch so notwendigen Arbeit außer Acht gelassen und vollkommen ignoriert. Dabei sollte allen klar sein: Auf einem toten Planeten gibt es keine Arbeitsplätze.
Du hast ja eine Weile lang geldfrei gelebt. Was haben Geld und Arbeit miteinander zu tun?
Tobi Rosswog: Tatsächlich habe ich von März 2013 bis September 2015 für 2,5 Jahre radikal konsequent geldfrei gelebt. Gleichzeitig ist mir wichtig zu betonen, dass ich das nur aufgrund verschiedener Privilegien so einfach leben konnte und diese wichtigen Erfahrungen sowie Perspektivwechsel außerhalb der Verwertungslogik zu sammeln. Im Grunde hängen nicht nur Geld und Arbeit unmittelbar zusammen, sondern auch Eigentum und die alles durchfließende Tauschlogik.
Wenn wir uns fragen, warum wir arbeiten, ist die Antwort ganz klar: Wir müssen ja Geld verdienen, um ein Dach über dem Kopf oder das Essen zu bezahlen. Wir verkaufen oder vermieten also unsere Lebenszeit an unsere Chef*in, um dafür etwas zu bekommen, damit wir unsere Grundbedürfnisse decken können. Ich finde das ziemlich umständlich – wir könnten uns doch besser direkt nach Bedürfnissen und Fähigkeiten organisieren.
Wieso ist »Arbeit ist die Ursache nahezu allen Elends in der Welt«?
Tobi Rosswog: Wenn wir in die Etymologie des Wortes gehen, finden wir folgendes: Die französischen und spanischen Worte für Arbeit »travail« und »trabajo« leiten sich von einem frühmittelalterlichen Folterinstrument ab, dem Trepalium. Kein Wunder also, dass Arbeit eher negativ konnotiert ist und mit Aussagen wie »Ich muss zur Arbeit« verknüpft wird. Mein Transformationsweg sieht so aus, dass ich dem Konstrukt und damit auch dem Wort »Arbeit« im Allgemeinen eine Absage erteilen mag. Was nicht bedeutet, dass wir nichts mehr tun. Ich bin fest davon überzeugt, dass der Mensch sich gestalterisch der Welt hingeben und gemeinwohldienlich beitragen mag. Deswegen eröffne ich das Buch auch mit »Arbeit? Nein danke! Faulsein? Keine Lust«. Wohl wissend, dass auch in der Faulheit und dem Müßiggang eine ganz wichtige Qualität liegt, die wir wieder erlernen und uns erlauben dürfen.
Kurz und knapp nochmal der Versuch, warum es in einer kapitalistischen Gesellschaft keine gute Arbeit geben kann. Dazu zitiere ich Friederike Habermann aus ihrem neuen (noch nicht veröffentlichten) Buch »Ausgetauscht – warum ein gutes Leben für alle tauschlogikfrei sein muss« erwähnt: »Denn auch wer als Lehrer*in sich aufopfert, richtet letztlich die Schüler*innen zu auf ein System, das auf Ausbeutung und Entfremdung beruht. Oder wer als Pflegerin älteren Menschen einen möglichst guten Lebensabend gestalten möchte, ist gezwungen, GPS-kontrolliert zur nächsten Patientin zu hetzen.« Aus diesem Sachzwang kommen wir nicht raus.
Du sagst, wir könnten uns eine Welt ohne Arbeit nicht vorstellen. Du auch nicht?
Tobi Rosswog: Das wir uns eine Gesellschaft jenseits der Arbeit nicht vorstellen können, schrieb ich in Anlehnung an die Feststellung von Ẑiẑek und Jameson, die meinten, dass es heute einfacher sei, sich das Ende der Welt vorstellen, als das Ende des Kapitalismus. Genau auf diese Phantasielosigkeit mag ich aufmerksam machen und natürlich auch auf die mentalen Infrastrukturen, denn Arbeit, Eigentum, Geld und Tauschlogik prägt unseren Alltag – und damit verbunden die Not sich durchzusetzen und sich in struktureller Gewalt zu begegnen.
Wir werden als Kinder im Kapitalismus sozialisiert und bereits in der Schule auf Wettbewerb gedrillt. Zwei entscheidende Fragen begegnen uns in der Biographie: In den ersten 20 Jahren, hören wir die Frage, was wir denn werden möchten. Und später, etwa bei Partys, hören wir dann immer wieder: Und, was machst Du so? Diese Frage zielt nicht darauf ab zu erfahren, was Menschen wirklich gerne machen. Es geht vielmehr um unsere Daseinsberechtigung. Was wir tun, um eine*r gute*r Bürger*in zu sein. Genau diese vermeintlichen Selbstverständlichkeiten lassen es kaum zu, uns anders zu denken.
Konkret: Dadurch, dass ich mich in den Räumen anderer Selbstverständlichkeiten bewege, die fern von Eigentum, Arbeit und Geld sowie Tausch gestaltet sind, kann ich vielleicht ein bisschen mehr erahnen, wie diese andere Welt aussehen könnte als Menschen, die im Hamsterrad sind. Gleichzeitig geht es mir nicht darum einen fünf-Punkte-Plan auf zu machen, sondern im Prozess den Weg zu gehen. Denn auf dem Weg werden uns viele Herausforderungen begegnen, die ich vom heutigen Punkt aus gar nicht vorhersehen kann. So ein Fenster als Utopie zu öffnen erscheint aus unserer heutigen Perspektive kaum möglich. Und doch lohnt es sich, den Horizont ein wenig zu erweitern und erste Gedanken zu wagen.
Fernando Birri antwortete in seinem Gedicht zu Utopie auf die Frage – wofür sie da wäre, obwohl sie sich doch auch immer wieder entfernt – ganz klar: Um uns auf sie zuzubewegen. »Die Welt ist was Gemachtes«, singt die Kleingeldprinzessin in ihrem Lied »Utopie«. Wir können sie selbst (mit-)formen. Die starr vorgegebenen Denkmuster von »Arbeit«, »Eigentum« sowie »Geld- und Tauschlogik« können wir Schritt für Schritt durchbrechen, sie neu denken und anders leben. Klar existiert das große Spielfeld des Kapitalismus weiter, doch wir können versuchen, so gut wie möglich anders zu spielen – Spielregeln zu brechen, neu aufzustellen und vermehrt zu kooperieren, statt gegeneinander zu zocken.
Arbeitest du?
Tobi Rosswog: Das was ich tue bezeichne ich nicht mehr als Arbeit. Unter anderem bin als freier Dozent alleine in diesem Jahr mit 150 Vorträgen an Universitäten, Kongressen, Konferenzen, an Schulen, auf Camps und Co unterwegs. Mit unserem BildungsKollektiv imago sind wir spielerisch ökonomisch nach dem Motto aktiv: „Bildung darf keine Ware sein, aber wenn Du Knatze hast, hau rein“. Dabei kommt sogar mehr zusammen als wir in unserer gemeinsamen Ökonomie brauchen, was wir dann verspenden. Es ist für mich ein Tätigsein aus intrinsischer Motivation. Beispielsweise ist für mich ganz entscheidend der Unterschied, dass ich nichts in der Erwartung nach einer Gegenleistung tue – etwa in Form von Geld. Deswegen mache ich auch viele Bildungsaktivitäten für Null Euro. Das einzige Kriterium ist, ob ich Zeit habe oder nicht. Es ist für mich ein Akt der Selbstbestimmung, der sinnhaften Verantwortungsübernahme, um wirklich das zu tun, was uns weiterbringt.
Was sind die Ideen, Praktiken und Strukturen, die in eine Welt ohne Arbeit führen?
Tobi Rosswog: Ich versuche drei Werkzeuge für den Prozess in eine Post-Work-Gesellschaft zu liefern und damit Fragen zu stellen:
- Suffizienz: Was brauche ich eigentlich wirklich? Wenn ich weniger Zeug brauche, habe ich mehr Zeit für anderes, weil ich nicht erst gegen Geld meine Lebenszeit verkaufen muss. Durch diesen Freiraum kann ich mich auf die Suche begeben, was ich wirklich in die Gesellschaft einbringen mag. Was ist also mein Talent, meine Berufung oder mein Potential?
- Sharing: Was kann ich alles teilen? Was ist sowieso schon vorhanden und lässt sich nutzen? Beispielsweise Umsonstläden, Kleiderschenkpartys, Foodsharing oder andere emanzipatorische Strukturen des Teilens lassen Wege in ein neues Miteinander erproben. Wo es nicht mehr um Eigentum, sondern Besitz geht.
- Subsistenz: Was kann ich beitragen? Die Idee, dass wir wieder vieles selber in die Hand nehmen, jenseits von Markt und Staat uns gemeinsam organisieren. Indem wir utopietaugliche Halbinseln schaffen, wo fern der Verwertungslogik, des Leistungsdrucks und der Selbstoptimierung, Räume anderer Selbstverständlichkeiten geschaffen werden. Wir werden tätig und organisieren Ernährung, Energie, Pflege und viele andere lebensnotwendige Dinge anders als bisher.
Daraus ergibt sich der Dreiklang: Geldfreier leben bedeutet arbeitsunabhängiger zu werden. Du hast dann mehr freie Zeit, um wirklich dein Talent, deine Berufung und dein Potential zu finden. Das kannst du dann gemeinwohldienlich einbringen und so auf drei Wegen zum Wandel beitragen: Widerstand leisten, Austausch anregen und Utopien leben.
Danke für das Interview!
[notification type=“notification_error“ ]
 After Work
After Work
Radikale Ideen für eine Gesellschaft jenseits der Arbeit: Sinnvoll tätig sein statt sinnlos schuften
Autor: Tobi Rosswog
Oekom Verlag | 144 Seiten | 15 Euro | ISBN 978-3962380564
[/notification]
Bildquelle: Fair Camp Berlin 2016





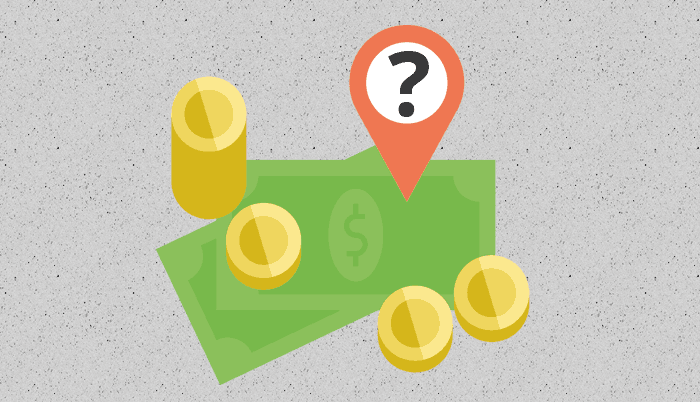
„Faulsein? Keine Lust“ den satzteil finde ich echt interessant. danke!
hey! endlich mal jemand, der ähnlich denkt, wie ich! 🙂 oder besser gesagt, wahrnimmt und beobachtet. arbeit ist irgendwie das letzte. ich weiß überhaupt nicht, warum man überhaupt davon als etwas gutes redet. weil genau, es ist das gegenteil von vergnügen! und das wort arbeit, die herleitung, kann diese beobachtung (und erfahrung) nicht treffender beschreiben: leid. ich würde nie auf die idee kommen, das freiwillig zu machen. guckt euch die jungen menschen an, ihre träume zerschmettert, auf ewig zerstört… tragen sie tabletts umher…. tote träume. …keine räume. … ich nenne arbeit absolute entrechtung. und zerstörung. nochmal zu den jungen leuten mit tabletts.. bedienen andere, unterworfen in hierachien… mein herz zerbricht über diese ganze scheiß arbeitswelt. die hauptschülerin bleibt der spasti, der die zimmer saubermacht und niemals einen freund findet im leben… immer allein fernsehen auf dem zimmer. unendlich gedisst. dieses heuchlerische, verachtende gerede über den wert der arbeit…und das gerede über die arbeitswelt, die leute haben wohl anscheinend keine augen im kopf, das fällt mir dazu ein! …ist alles weltfremd! wie gesagt, wie blind muss man sein. liebe grüße!
Das hört sich für mich doch sehr plakativ an und es polarisiert unnötig.Ich bin der Meinung das die jetzige Arbeitswelt Ausdruck unseres Bewusstseins ist. Diese Arbeitswelt war und ist in Entwicklung. Nach meiner Beobachtung arbeiten eine ganze Menge Menschen aus inneren Motiven heraus zum Teil auch sehr selbstlos….
Ich selber bin als Unternehmer tätig und habe immer das getan was mir am Herzen lag, was ich als sinnvoll angesehen habe. Veränderungen beginnen im eigenen Bewusstsein und dann wird es auch möglich neue Formen den Wirtschaftens zu entwickeln.
Hallo lieber Achim, ja ich sehe das auch differenzierter als Tobi. Aber was auf jeden Fall klappt ist, dass diese scharzweiß-Sicht zum Nachdenken anregt 🙂